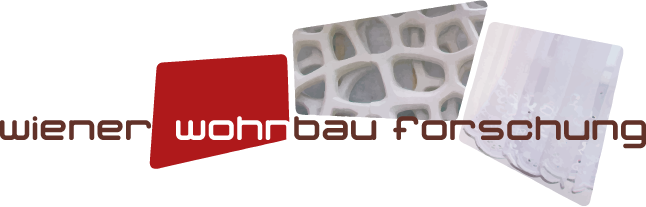Wohnen im Hochhaus. Eine Studie zu Wohnkultur und Wohnqualität in Wiener Wohnhochhäusern.
Ausgangssituation
Wohnen im Wohnhochhaus hatte in Wien lange Zeit eine Randstellung: Von vereinzelten Projekten abgesehen, sind in Wien relativ wenige Spuren des weltweiten Hochhausbooms auszumachen, dies gilt für die Architekturmoderne (Hochhaus Herrengasse) und den Wiederaufbau (Turm des Körner-Hofs) ebenso wie für die Periode der Stadterweiterung und Suburbanisierung (Alterlaa, Mitterhofergasse), als in vielen europäischen Städten vor allem im sozial geförderten Sektor der Hochhausbau boomte und für lange Zeit das Bild von Wohntürmen als potentielle „slums in the sky“ (Lynsey Hanley) prägte. Wie in anderen Metropolen Europas erfährt seit der Jahrtausendwende auch in Wien das Wohnhochhaus als urbane Wohnform vermehrte Aufmerksamkeit. In der Diskussion dominiert, neben Aspekten der Urbanität und Attraktivität der Stadt im globalen Städtewettbewerb, der Wohndruck aufgrund des dynamischen Bevölkerungswachstums: Aktuelle Prognosen berechnen einen Zuwachs der Wiener Bevölkerung von aktuell 1,75 auf über 2 Millionen um das Jahr 2030. Die auch international viel diskutierten Fragen der stadträumlichen Einbettung, von Wohnqualität und Wohnkultur, aber auch in Bezug auf die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit vertikal verdichteten Wohnens bilden den Ausgangspunkt der Studie.
Inhalte und Zielsetzungen
Ziel der Studie war es, herauszufinden, welchen Beitrag das Wohnhochhaus, im Kontext ausgeprägten Städtewachstums, zum steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigem und zugleich leistbarem Wohnraum leisten kann, inwieweit das Wohnhochhaus Angebote für spezifische Wohnkulturen und Lebensstile bietet und mit welchen stadt- und sozialräumlichen Herausforderungen die Errichtung von Wohnhochhäusern verbunden ist. Anknüpfend an eine explorative Pilotstudie von Herbst 2013 wurden für eine Auswahl an fünf Wohntürmen sowohl sozialstrukturelle („wer wohnt in Wohnhochhäusern“) und soziokulturelle Fragestellungen („wie wird in Wohnhochhäusern gewohnt“) untersucht. Geprüft wurde, wie das Wohnen in Hochhäusern von Bewohnerinnen und Bewohnern subjektiv erlebt und wahrgenommen wird und wie unterschiedliche Dimensionen der Wohnqualität (funktional, sozial, sozialpsychologisch, ästhetisch, ökonomisch) bewertet werden; inwieweit Wohnbedingungen und konkretes Wohnerleben mit den Wohnbedürfnissen korrespondieren und das Wohnen im Wohnhochhaus spezifische Themen und Sorgen mobilisiert; und wie die Wahrnehmung des Wohnhochhauses im Außenverhältnis (Image, Attraktivität, nachbarschaftliche Situation), auch in Hinblick auf die Platzierung und Einbettung im Stadtraum erfolgt; schließlich in welcher Weise das Wohnen in Wohnhochhäusern durch spezifische wohnkulturelle Präferenzen charakterisiert ist, insofern eine soziokulturelle Milieubildung begünstigt und ein entsprechendes Zielpublikum adressiert wird.
Die Ergebnisse der Studie erlauben nicht nur eine Typisierung des Wohnens im Hochhaus, sondern zugleich die Identifizierung charakteristischer Herausforderungen und Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Wohnen im Hochhaus, sei es in Bezug auf seine Alltagstauglichkeit (Barrierefreiheit, technische Verwundbarkeit), das soziale Gefüge (Nachbarschaft) oder auch im Außenverhältnis (städtebauliche und sozialräumliche Einbettung im Stadtquartier) stellen.
Methodische Vorgehensweise
Aufbauend auf den Ergebnissen der explorativen Vorstudie wurden in Absprache mit dem Auftraggeber unter Berücksichtigung verschiedener Gesichtspunkte wie Stadtlage, Segment des Wohnungsmarktes, architektonischer Typus, Bauperiode fünf Wohnhochhäuser als Untersuchungseinheiten definiert, darunter vier Wohntürme aus der jüngsten Bauperiode nach 2000 (Monte Verde Tower, Hochhaus Simmering, Hochstädtplatz, K6 -Tower) sowie ein Turm aus den 1970er Jahren (Geiselbergstraße) zu Vergleichszwecken. Kern der Studie bildete eine standardisierte Fragebogenerhebung zu den Themen Wohnerleben und Wohnzufriedenheit, Nachbarschaft, Bewertung der Wohnung, des Wohnhauses und der Wohnumgebung, Nutzung von Gemeinschafts- und Freiräumen, Wohnvorstellungen und Wohnmilieus. Insgesamt konnten 36% der Bewohnerinnen und Bewohner der genannten Wohntürme erreicht werden, die höchste Ausschöpfung wurde in den Wohnhäusern Simmering und Hochstädtplatz mit jeweils knapp über 40%, die geringste im Wohnhaus Geiselbergstraße mit knapp 30% erzielt. Zur Kontrolle der Stichprobe standen Daten aus dem Melderegister der MA 23 auf Baublockebene sowie von den Bauträgern bereitgestellte anonymisierte Daten zur Verfügung.
Begleitend zu den quantitativen Erhebungen wurden, zur differenzierten Kenntnis sowohl der Wohnmilieus und Wohnbedürfnisse als auch der Problemlagen und Handlungsbedarfe, vertiefende Interviews mit BewohnerInnen sowie Gespräche mit Hausbetreuern und Bauträgern durchgeführt. Für die Analyse und Bewertung der stadträumlichen Einbettung fanden Sozialraumbegehungen statt, diese wurden auch für die Erstellung von Bewegungsskizzen und für Gespräche mit AnwohnerInnen und AnrainerInnen genutzt. Ergänzend wurden Online-Recherchen zu Medienberichten, Bewohner-Foren und öffentlichen Dokumenten über die einzelnen Wohnprojekte sowie einige zusätzliche Experteninterviews, unter anderem über das Good-Practice-Beispiel der Nutzung von Gemeinschaftsräumen im Wohnhochhaus Alt-Erlaa, durchgeführt.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Einzelfallanalysen und Fragebogenerhebung erlauben eine Typisierung der ausgewählten Hochhäuser nach Finanzierungsmodell, Eigentumsform, Ausstattung, Zielgruppen und Stadtlage: So findet sich der Typ des Investoren-Wohnbaus für Angehörige kaufkräftigerer Zielgruppen (Monte Verde Tower) und der barrierefreie, geförderte Wohnbau für Mittelschichten im Gewerbegebiet (K6) ebenso wie Typen sozial durchmischter vertikaler Verdichtung in innerstädtischer Lage (Hochstädtplatz) und in polyzentrischer Stadtregion (Simmering), schließlich der Typ des Plattenwohnbaus in peripherer Lage im Grünen (Geiselbergstraße). Gemeinsam ist den neueren Hochhäusern ihre symbolische Funktion als architektonische Markierungen in den sich wandelnden städtebaulichen Strukturen, insbesondere der polyzentrischen Stadt.
Auch wenn die untersuchten Wohntürme sich in Bezug auf ihren Standort, ihre Eigentumsstruktur, ihre Architektur und nicht zuletzt ihre Demographie und Sozialstruktur unterscheiden, so repräsentiert das Wohnen im Hochhaus, zumindest in der im Rahmen dieser Forschung untersuchten Form, primär eine Wohnform für soziale Mittelschichten. Zwar ist in manchen Segmenten aufgrund von Förderungen (inklusive Superförderung) die Schwelle der Eintrittskosten teilweise relativ stark abgesenkt, auch wird teilweise soziale Durchmischung etwa durch die Einbeziehung von Einrichtungen wie betreutes Wohnen oder Studierendenwohnungen angestrebt; der Anteil an ökonomisch schwächer gestellten Bevölkerungsgruppen ist jedoch gering, während sich die Wohntürme nicht zuletzt aus Kostengründen immer auch (in manchen Fällen sogar vornehmlich) an eine kaufkräftigere Bewohnerschaft adressieren. Diese betrachtet die Wohnung als eine Wertanlage und schätzt die repräsentative Wirkung (Synonym für Modernität und Weltläufigkeit; „Wohnung mit Ausblick“). Besonders ausgeprägt ist dies im sogenannten Investoren-Wohnbau, hier ist der Anteil an höher qualifizierten Personen, sowohl älteren wohlhabenden als auch jüngeren, oftmals in Partnerschaft sowie am Beginn der Familiengründung, überdurchschnittlich. Gleichzeitig existiert in allen Wohnhochhäusern eine vertikale soziale Differenzierung: Finden sich teure Eigentumswohnungen und teurere Mietwohnungen meist in den oberen Stockwerken (Fernsicht, Helligkeit, Ruhe), sinkt in den unteren Etagenlagen tendenziell der Sozialstatus der Bewohnerinnen und Bewohner. Beeinträchtigungen durch Lärm, fehlende Aussicht, Lichtmangel oder Winde sind hier besonders ausgeprägt.
In der Befragung konnte eine hohe Wohnzufriedenheit festgestellt werden, diese spiegelt sich auch in einer ausgeprägten Bleibeabsicht sowie im Umstand, dass eine große Mehrheit das Wohnhochhaus auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen würde. Eine Ausnahme bildet der Wohnbau der 1970er Jahre, in dem ein größerer Anteil an Personen lebt, die bereits in Pension sind und wo die geringer ausgeprägte Wohnzufriedenheit auch veränderte Ansprüche an das Wohnen zum Ausdruck bringt. Als wichtigste Vorteile des Wohnens im Wohnhochhaus werden von den Befragten die Aussicht und der Prestigewert genannt, als wichtigste Nachteile Beeinträchtigungen durch Außeneinflüsse (Wind, Hitze, Lärm), aber auch Sozialstress (Anonymität) sowie die teilweise erhebliche Kostenbelastung.

 Das Wohnen im Wohnturm korrespondiert mit individualisierten Wohnbedürfnissen und Wohnerleben. Auch in dieser Hinsicht repräsentiert das Wohnen im Hochhaus, in den untersuchten Wohntürmen, eine Wohnform für Mittelschichten. In der Befragung zeigt sich, dass dem Wohnen, als Lebensbereich, eine insgesamt sehr hohe Bedeutung zugemessen wird. Zentrale Inhalte sind Geborgenheit, Rückzug und Intimität, Wohnen im Grünen und Zentrumslage. Durch die Befragung konnte gezeigt werden, dass „Materialisten“, d.h. Personen, die auf beruflichen Erfolg und materiellen Lebensstil, und „Kreative“, zum Beispiel neue Selbständige, jene Wohnmilieus sind, die sich am stärksten vom Wohnen im Wohnturm angesprochen fühlen. Für beide Milieus ist ein individualisierter Lebens- und Wohnstil kennzeichnend, ohne ausgeprägte Ortsbindung und mit sozialen Beziehungsstrukturen, die sich über den Stadtraum ausstrecken. Familien oder Personen, die einen weniger privatisierten und individualisierten Lebens- und Wohnstil pflegen, fühlen sich durch das Wohnen im Wohnturm weniger angesprochen und äußern auch seltener eine dauerhafte Bleibeabsicht. Gerade hochpreisige Segmente stützen die Orientierung nach Innen und in die Privatheit („für sich bleiben“), Eigentum verstärkt das Interesse an Werterhaltung, das Bedürfnis nach aktiver Nachbarschaft ist wenig ausgeprägt.
Das Wohnen im Wohnturm korrespondiert mit individualisierten Wohnbedürfnissen und Wohnerleben. Auch in dieser Hinsicht repräsentiert das Wohnen im Hochhaus, in den untersuchten Wohntürmen, eine Wohnform für Mittelschichten. In der Befragung zeigt sich, dass dem Wohnen, als Lebensbereich, eine insgesamt sehr hohe Bedeutung zugemessen wird. Zentrale Inhalte sind Geborgenheit, Rückzug und Intimität, Wohnen im Grünen und Zentrumslage. Durch die Befragung konnte gezeigt werden, dass „Materialisten“, d.h. Personen, die auf beruflichen Erfolg und materiellen Lebensstil, und „Kreative“, zum Beispiel neue Selbständige, jene Wohnmilieus sind, die sich am stärksten vom Wohnen im Wohnturm angesprochen fühlen. Für beide Milieus ist ein individualisierter Lebens- und Wohnstil kennzeichnend, ohne ausgeprägte Ortsbindung und mit sozialen Beziehungsstrukturen, die sich über den Stadtraum ausstrecken. Familien oder Personen, die einen weniger privatisierten und individualisierten Lebens- und Wohnstil pflegen, fühlen sich durch das Wohnen im Wohnturm weniger angesprochen und äußern auch seltener eine dauerhafte Bleibeabsicht. Gerade hochpreisige Segmente stützen die Orientierung nach Innen und in die Privatheit („für sich bleiben“), Eigentum verstärkt das Interesse an Werterhaltung, das Bedürfnis nach aktiver Nachbarschaft ist wenig ausgeprägt.
Das Wohnen im Wohnturm ist, in den untersuchten Türmen, durch eine fragile soziale Kohäsion gekennzeichnet. Radius und Intensität der nachbarschaftlichen Beziehungen und Aktivitäten sind eingeschränkt: Rund die Hälfte der Befragten berichtet keine wie immer gearteten Kontakte mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. Gemeinschaftliche Aktivitäten unter Nachbarn sind selektiv. In manchen Wohntürmen stärker ausgeprägt sind Mechanismen der sozialen Kontrolle (gemeinsames Achten auf Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit). Nachbarschaftliche Konflikte entstehen im Zusammenhang mit der Nutzung von Gemeinschaftsflächen, sie bedürfen zu ihrer Regelung und Lösung professionell geschulter Ansprechpartner. Eine stärkere Beteiligung an gemeinschaftlichen Aktivitäten, einschließlich in der Organisation der MieterInneninteressen konnte nur in einem der untersuchten Wohntürme beobachtet werden, und zwar im Zusammenhang mit einem Konflikt mit dem Hauseigentümer. Als Kontakt- bzw. Interaktionszonen erfüllen die Gemeinschafträume (die meist nur mit Voranmeldung nutzbar sind) nicht die gedachte Funktion. Gemeinschaftsräume werden generell nicht so stark angenommen oder eher als ein Prestigefaktor angesehen (z.B. hauseigene Fitness-Räume oder Wellnessbereiche). Sofern ein Wunsch nach gemeinschaftlichen Aktivitäten, ist dieser eher lebensstilorientiert (z.B. Walkinggruppen). Eine Ausnahme bildet das Pool am Dach, welches als Freizeitangebot von der BewohnerInnenschaft angenommen und gewünscht wird. Auch andere charakteristische Begegnungsorte im verdichteten Wohnbau wie Stiegenhaus oder Waschküche erfüllen nur selten eine Interaktionsfunktion; ein Ort der Begegnung ist der Lift, der jedoch zugleich einen Unsicherheitsfaktor darstellt. Wohntürme sind so gesehen durch soziale Verwundbarkeit gekennzeichnet. Dies zeigt sich nicht nur in den Begegnungssituationen voneinander fremden BewohnerInnen bzw. Nachbarn, sondern auch in Bezug auf die Zugänglichkeit der Gebäude: Hochhäuser mit Mischnutzung (Arztpraxen, soziale Einrichtungen, Gastronomie) scheinen gegenüber Vandalismus, Verschmutzung, Einbrüchen, aber auch gefühlter Unsicherheit stärker ausgesetzt. Wie die Befragung zeigt, fördert eine fixe professionelle Hausbetreuung das subjektive Sicherheitsgefühl und erfüllt zudem eine vitale Vernetzungs- und Informationsfunktion, was sich wiederum insgesamt positiv auf die Wohnzufriedenheit auswirkt.
Wohnhochhäuser sind auch technisch vulnerable Baukörper. Auch aus diesem Grund bildet Sicherheit ein zentrales Thema für die Bewohnerinnen und Bewohner. Dies betrifft nicht nur die notwendige Erschließung der Wohnungen mittels Aufzügen, sondern auch Faktoren wie Feuermeldeanlage, Zentralheizungen oder Lüftungsanlagen. All diese Ausstattungsmerkmale müssen ständig gewartet, erneuert und kontrolliert werden und bilden einen im Vergleich zum traditionellen Wohnbau enormen Kostenfaktor, und zwar sowohl für die Bauträger als auch für die Bewohnerschaft. Die Einrichtung von fixen Objekt- und Hausbetreuern, als modernes Facility Management, erhöht sowohl objektiv, etwa durch rascheres Erkennen von und Reagieren auf Gebrechen, und subjektiv die Sicherheit und vermindert Kosten durch die Früherkennung technischer Gebrechen. Eine fixe Hausbetreuung fungiert zudem als Ansprechpartner für die Bewohnerschaft (Schnittstelle zwischen Eigentümer/ Bauträger und Bewohnerschaft) und trägt auf diese Weise nicht nur zur Werterhaltung des Gebäudes, sondern auch zur BewohnerInnenzufriedenheit bei.
Eine zentrale Thematik des Wohnens im Wohnhochhaus ist die stadträumliche Einbettung. Viele der Wohnbauten entstehen in neuen urbanen Stadtteilzentren oder neu aufgeschlossenen Gewerbegebieten nach dem Modell der polyzentrischen Stadt. Der öffentliche Raum des Stadtquartiers ist vielfach gekennzeichnet von versiegelten Flächen, ohne Aufenthaltsqualität, mit Individualverkehr und hoher Lärmbelastung, es handelt sich oftmals um Viertel ohne Wiedererkennungswert. Durch die Freiraumgestaltung und Ausstattung der Hochhäuser (mit Shopping Malls etwa) wir die Inselwirkung der Hochhäuser verstärkt. In den untersuchten Wohnhochhäusern zeigt sich eine gewisse Konzeptlosigkeit, oftmals sind die Freiräume so gestaltet, dass sie nur eine transitorische oder repräsentative Funktion erfüllen; teilweise entsprechen sie nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen. Hier zeigen sich besonders nachteiligen Seiten des Investoren-Städtebaus. Bauträger könnten stärker in die Pflicht genommen werden, Freiräume zu schaffen mit Aufenthaltsqualität auch für die Nachbarschaften in der Umgebung.
Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, strukturelle Spannungen zu erkennen und aktiv zu gestalten, um ihre latenten Konflikthaftigkeit zu minimieren. Strukturelle Spannungen existieren entlang von vier Linien: Zum einen im Außenbezug zwischen dem Wohnbau und der stadträumlichen Umgebung; zum zweiten im Innenverhältnis zwischen sozialer Durchmischung und sozialer Ungleichheit; zum dritten in der Zeitdimension zwischen der Lebenszeit eines Wohnhauses und den veränderten Nutzungsbedürfnissen einer sich verändernden (alternden oder ausgetauschten) Bewohnerschaft; viertens in Bezug auf den Lebensstil zwischen Individualisierung und Gemeinschaftsbildung.
Ausgangssituation
Wohnen im Wohnhochhaus hatte in Wien lange Zeit eine Randstellung: Von vereinzelten Projekten abgesehen, sind in Wien relativ wenige Spuren des weltweiten Hochhausbooms auszumachen, dies gilt für die Architekturmoderne (Hochhaus Herrengasse) und den Wiederaufbau (Turm des Körner-Hofs) ebenso wie für die Periode der Stadterweiterung und Suburbanisierung (Alterlaa, Mitterhofergasse), als in vielen europäischen Städten vor allem im sozial geförderten Sektor der Hochhausbau boomte und für lange Zeit das Bild von Wohntürmen als potentielle „slums in the sky“ (Lynsey Hanley) prägte. Wie in anderen Metropolen Europas erfährt seit der Jahrtausendwende auch in Wien das Wohnhochhaus als urbane Wohnform vermehrte Aufmerksamkeit. In der Diskussion dominiert, neben Aspekten der Urbanität und Attraktivität der Stadt im globalen Städtewettbewerb, der Wohndruck aufgrund des dynamischen Bevölkerungswachstums: Aktuelle Prognosen berechnen einen Zuwachs der Wiener Bevölkerung von aktuell 1,75 auf über 2 Millionen um das Jahr 2030. Die auch international viel diskutierten Fragen der stadträumlichen Einbettung, von Wohnqualität und Wohnkultur, aber auch in Bezug auf die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit vertikal verdichteten Wohnens bilden den Ausgangspunkt der Studie.
Inhalte und Zielsetzungen
Ziel der Studie war es, herauszufinden, welchen Beitrag das Wohnhochhaus, im Kontext ausgeprägten Städtewachstums, zum steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigem und zugleich leistbarem Wohnraum leisten kann, inwieweit das Wohnhochhaus Angebote für spezifische Wohnkulturen und Lebensstile bietet und mit welchen stadt- und sozialräumlichen Herausforderungen die Errichtung von Wohnhochhäusern verbunden ist. Anknüpfend an eine explorative Pilotstudie von Herbst 2013 wurden für eine Auswahl an fünf Wohntürmen sowohl sozialstrukturelle („wer wohnt in Wohnhochhäusern“) und soziokulturelle Fragestellungen („wie wird in Wohnhochhäusern gewohnt“) untersucht. Geprüft wurde, wie das Wohnen in Hochhäusern von Bewohnerinnen und Bewohnern subjektiv erlebt und wahrgenommen wird und wie unterschiedliche Dimensionen der Wohnqualität (funktional, sozial, sozialpsychologisch, ästhetisch, ökonomisch) bewertet werden; inwieweit Wohnbedingungen und konkretes Wohnerleben mit den Wohnbedürfnissen korrespondieren und das Wohnen im Wohnhochhaus spezifische Themen und Sorgen mobilisiert; und wie die Wahrnehmung des Wohnhochhauses im Außenverhältnis (Image, Attraktivität, nachbarschaftliche Situation), auch in Hinblick auf die Platzierung und Einbettung im Stadtraum erfolgt; schließlich in welcher Weise das Wohnen in Wohnhochhäusern durch spezifische wohnkulturelle Präferenzen charakterisiert ist, insofern eine soziokulturelle Milieubildung begünstigt und ein entsprechendes Zielpublikum adressiert wird.
Die Ergebnisse der Studie erlauben nicht nur eine Typisierung des Wohnens im Hochhaus, sondern zugleich die Identifizierung charakteristischer Herausforderungen und Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Wohnen im Hochhaus, sei es in Bezug auf seine Alltagstauglichkeit (Barrierefreiheit, technische Verwundbarkeit), das soziale Gefüge (Nachbarschaft) oder auch im Außenverhältnis (städtebauliche und sozialräumliche Einbettung im Stadtquartier) stellen.
Methodische Vorgehensweise
Aufbauend auf den Ergebnissen der explorativen Vorstudie wurden in Absprache mit dem Auftraggeber unter Berücksichtigung verschiedener Gesichtspunkte wie Stadtlage, Segment des Wohnungsmarktes, architektonischer Typus, Bauperiode fünf Wohnhochhäuser als Untersuchungseinheiten definiert, darunter vier Wohntürme aus der jüngsten Bauperiode nach 2000 (Monte Verde Tower, Hochhaus Simmering, Hochstädtplatz, K6 -Tower) sowie ein Turm aus den 1970er Jahren (Geiselbergstraße) zu Vergleichszwecken. Kern der Studie bildete eine standardisierte Fragebogenerhebung zu den Themen Wohnerleben und Wohnzufriedenheit, Nachbarschaft, Bewertung der Wohnung, des Wohnhauses und der Wohnumgebung, Nutzung von Gemeinschafts- und Freiräumen, Wohnvorstellungen und Wohnmilieus. Insgesamt konnten 36% der Bewohnerinnen und Bewohner der genannten Wohntürme erreicht werden, die höchste Ausschöpfung wurde in den Wohnhäusern Simmering und Hochstädtplatz mit jeweils knapp über 40%, die geringste im Wohnhaus Geiselbergstraße mit knapp 30% erzielt. Zur Kontrolle der Stichprobe standen Daten aus dem Melderegister der MA 23 auf Baublockebene sowie von den Bauträgern bereitgestellte anonymisierte Daten zur Verfügung.
Begleitend zu den quantitativen Erhebungen wurden, zur differenzierten Kenntnis sowohl der Wohnmilieus und Wohnbedürfnisse als auch der Problemlagen und Handlungsbedarfe, vertiefende Interviews mit BewohnerInnen sowie Gespräche mit Hausbetreuern und Bauträgern durchgeführt. Für die Analyse und Bewertung der stadträumlichen Einbettung fanden Sozialraumbegehungen statt, diese wurden auch für die Erstellung von Bewegungsskizzen und für Gespräche mit AnwohnerInnen und AnrainerInnen genutzt. Ergänzend wurden Online-Recherchen zu Medienberichten, Bewohner-Foren und öffentlichen Dokumenten über die einzelnen Wohnprojekte sowie einige zusätzliche Experteninterviews, unter anderem über das Good-Practice-Beispiel der Nutzung von Gemeinschaftsräumen im Wohnhochhaus Alt-Erlaa, durchgeführt.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Einzelfallanalysen und Fragebogenerhebung erlauben eine Typisierung der ausgewählten Hochhäuser nach Finanzierungsmodell, Eigentumsform, Ausstattung, Zielgruppen und Stadtlage: So findet sich der Typ des Investoren-Wohnbaus für Angehörige kaufkräftigerer Zielgruppen (Monte Verde Tower) und der barrierefreie, geförderte Wohnbau für Mittelschichten im Gewerbegebiet (K6) ebenso wie Typen sozial durchmischter vertikaler Verdichtung in innerstädtischer Lage (Hochstädtplatz) und in polyzentrischer Stadtregion (Simmering), schließlich der Typ des Plattenwohnbaus in peripherer Lage im Grünen (Geiselbergstraße). Gemeinsam ist den neueren Hochhäusern ihre symbolische Funktion als architektonische Markierungen in den sich wandelnden städtebaulichen Strukturen, insbesondere der polyzentrischen Stadt.
Auch wenn die untersuchten Wohntürme sich in Bezug auf ihren Standort, ihre Eigentumsstruktur, ihre Architektur und nicht zuletzt ihre Demographie und Sozialstruktur unterscheiden, so repräsentiert das Wohnen im Hochhaus, zumindest in der im Rahmen dieser Forschung untersuchten Form, primär eine Wohnform für soziale Mittelschichten. Zwar ist in manchen Segmenten aufgrund von Förderungen (inklusive Superförderung) die Schwelle der Eintrittskosten teilweise relativ stark abgesenkt, auch wird teilweise soziale Durchmischung etwa durch die Einbeziehung von Einrichtungen wie betreutes Wohnen oder Studierendenwohnungen angestrebt; der Anteil an ökonomisch schwächer gestellten Bevölkerungsgruppen ist jedoch gering, während sich die Wohntürme nicht zuletzt aus Kostengründen immer auch (in manchen Fällen sogar vornehmlich) an eine kaufkräftigere Bewohnerschaft adressieren. Diese betrachtet die Wohnung als eine Wertanlage und schätzt die repräsentative Wirkung (Synonym für Modernität und Weltläufigkeit; „Wohnung mit Ausblick“). Besonders ausgeprägt ist dies im sogenannten Investoren-Wohnbau, hier ist der Anteil an höher qualifizierten Personen, sowohl älteren wohlhabenden als auch jüngeren, oftmals in Partnerschaft sowie am Beginn der Familiengründung, überdurchschnittlich. Gleichzeitig existiert in allen Wohnhochhäusern eine vertikale soziale Differenzierung: Finden sich teure Eigentumswohnungen und teurere Mietwohnungen meist in den oberen Stockwerken (Fernsicht, Helligkeit, Ruhe), sinkt in den unteren Etagenlagen tendenziell der Sozialstatus der Bewohnerinnen und Bewohner. Beeinträchtigungen durch Lärm, fehlende Aussicht, Lichtmangel oder Winde sind hier besonders ausgeprägt.
In der Befragung konnte eine hohe Wohnzufriedenheit festgestellt werden, diese spiegelt sich auch in einer ausgeprägten Bleibeabsicht sowie im Umstand, dass eine große Mehrheit das Wohnhochhaus auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen würde. Eine Ausnahme bildet der Wohnbau der 1970er Jahre, in dem ein größerer Anteil an Personen lebt, die bereits in Pension sind und wo die geringer ausgeprägte Wohnzufriedenheit auch veränderte Ansprüche an das Wohnen zum Ausdruck bringt. Als wichtigste Vorteile des Wohnens im Wohnhochhaus werden von den Befragten die Aussicht und der Prestigewert genannt, als wichtigste Nachteile Beeinträchtigungen durch Außeneinflüsse (Wind, Hitze, Lärm), aber auch Sozialstress (Anonymität) sowie die teilweise erhebliche Kostenbelastung.

Das Wohnen im Wohnturm ist, in den untersuchten Türmen, durch eine fragile soziale Kohäsion gekennzeichnet. Radius und Intensität der nachbarschaftlichen Beziehungen und Aktivitäten sind eingeschränkt: Rund die Hälfte der Befragten berichtet keine wie immer gearteten Kontakte mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. Gemeinschaftliche Aktivitäten unter Nachbarn sind selektiv. In manchen Wohntürmen stärker ausgeprägt sind Mechanismen der sozialen Kontrolle (gemeinsames Achten auf Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit). Nachbarschaftliche Konflikte entstehen im Zusammenhang mit der Nutzung von Gemeinschaftsflächen, sie bedürfen zu ihrer Regelung und Lösung professionell geschulter Ansprechpartner. Eine stärkere Beteiligung an gemeinschaftlichen Aktivitäten, einschließlich in der Organisation der MieterInneninteressen konnte nur in einem der untersuchten Wohntürme beobachtet werden, und zwar im Zusammenhang mit einem Konflikt mit dem Hauseigentümer. Als Kontakt- bzw. Interaktionszonen erfüllen die Gemeinschafträume (die meist nur mit Voranmeldung nutzbar sind) nicht die gedachte Funktion. Gemeinschaftsräume werden generell nicht so stark angenommen oder eher als ein Prestigefaktor angesehen (z.B. hauseigene Fitness-Räume oder Wellnessbereiche). Sofern ein Wunsch nach gemeinschaftlichen Aktivitäten, ist dieser eher lebensstilorientiert (z.B. Walkinggruppen). Eine Ausnahme bildet das Pool am Dach, welches als Freizeitangebot von der BewohnerInnenschaft angenommen und gewünscht wird. Auch andere charakteristische Begegnungsorte im verdichteten Wohnbau wie Stiegenhaus oder Waschküche erfüllen nur selten eine Interaktionsfunktion; ein Ort der Begegnung ist der Lift, der jedoch zugleich einen Unsicherheitsfaktor darstellt. Wohntürme sind so gesehen durch soziale Verwundbarkeit gekennzeichnet. Dies zeigt sich nicht nur in den Begegnungssituationen voneinander fremden BewohnerInnen bzw. Nachbarn, sondern auch in Bezug auf die Zugänglichkeit der Gebäude: Hochhäuser mit Mischnutzung (Arztpraxen, soziale Einrichtungen, Gastronomie) scheinen gegenüber Vandalismus, Verschmutzung, Einbrüchen, aber auch gefühlter Unsicherheit stärker ausgesetzt. Wie die Befragung zeigt, fördert eine fixe professionelle Hausbetreuung das subjektive Sicherheitsgefühl und erfüllt zudem eine vitale Vernetzungs- und Informationsfunktion, was sich wiederum insgesamt positiv auf die Wohnzufriedenheit auswirkt.
Wohnhochhäuser sind auch technisch vulnerable Baukörper. Auch aus diesem Grund bildet Sicherheit ein zentrales Thema für die Bewohnerinnen und Bewohner. Dies betrifft nicht nur die notwendige Erschließung der Wohnungen mittels Aufzügen, sondern auch Faktoren wie Feuermeldeanlage, Zentralheizungen oder Lüftungsanlagen. All diese Ausstattungsmerkmale müssen ständig gewartet, erneuert und kontrolliert werden und bilden einen im Vergleich zum traditionellen Wohnbau enormen Kostenfaktor, und zwar sowohl für die Bauträger als auch für die Bewohnerschaft. Die Einrichtung von fixen Objekt- und Hausbetreuern, als modernes Facility Management, erhöht sowohl objektiv, etwa durch rascheres Erkennen von und Reagieren auf Gebrechen, und subjektiv die Sicherheit und vermindert Kosten durch die Früherkennung technischer Gebrechen. Eine fixe Hausbetreuung fungiert zudem als Ansprechpartner für die Bewohnerschaft (Schnittstelle zwischen Eigentümer/ Bauträger und Bewohnerschaft) und trägt auf diese Weise nicht nur zur Werterhaltung des Gebäudes, sondern auch zur BewohnerInnenzufriedenheit bei.
Eine zentrale Thematik des Wohnens im Wohnhochhaus ist die stadträumliche Einbettung. Viele der Wohnbauten entstehen in neuen urbanen Stadtteilzentren oder neu aufgeschlossenen Gewerbegebieten nach dem Modell der polyzentrischen Stadt. Der öffentliche Raum des Stadtquartiers ist vielfach gekennzeichnet von versiegelten Flächen, ohne Aufenthaltsqualität, mit Individualverkehr und hoher Lärmbelastung, es handelt sich oftmals um Viertel ohne Wiedererkennungswert. Durch die Freiraumgestaltung und Ausstattung der Hochhäuser (mit Shopping Malls etwa) wir die Inselwirkung der Hochhäuser verstärkt. In den untersuchten Wohnhochhäusern zeigt sich eine gewisse Konzeptlosigkeit, oftmals sind die Freiräume so gestaltet, dass sie nur eine transitorische oder repräsentative Funktion erfüllen; teilweise entsprechen sie nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen. Hier zeigen sich besonders nachteiligen Seiten des Investoren-Städtebaus. Bauträger könnten stärker in die Pflicht genommen werden, Freiräume zu schaffen mit Aufenthaltsqualität auch für die Nachbarschaften in der Umgebung.
Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, strukturelle Spannungen zu erkennen und aktiv zu gestalten, um ihre latenten Konflikthaftigkeit zu minimieren. Strukturelle Spannungen existieren entlang von vier Linien: Zum einen im Außenbezug zwischen dem Wohnbau und der stadträumlichen Umgebung; zum zweiten im Innenverhältnis zwischen sozialer Durchmischung und sozialer Ungleichheit; zum dritten in der Zeitdimension zwischen der Lebenszeit eines Wohnhauses und den veränderten Nutzungsbedürfnissen einer sich verändernden (alternden oder ausgetauschten) Bewohnerschaft; viertens in Bezug auf den Lebensstil zwischen Individualisierung und Gemeinschaftsbildung.
Fakten
- Projektträger
Institut für Soziologie, Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Wien - Projektteam
Christoph Reinprecht
Cornelia Dlabaja - Laufzeit
03/2014 - 12/2014 - Kontakt
christoph.reinprecht[at]univie.ac.at - Downloads Abstract 294.59 KB
Projektbericht 5.62 MB